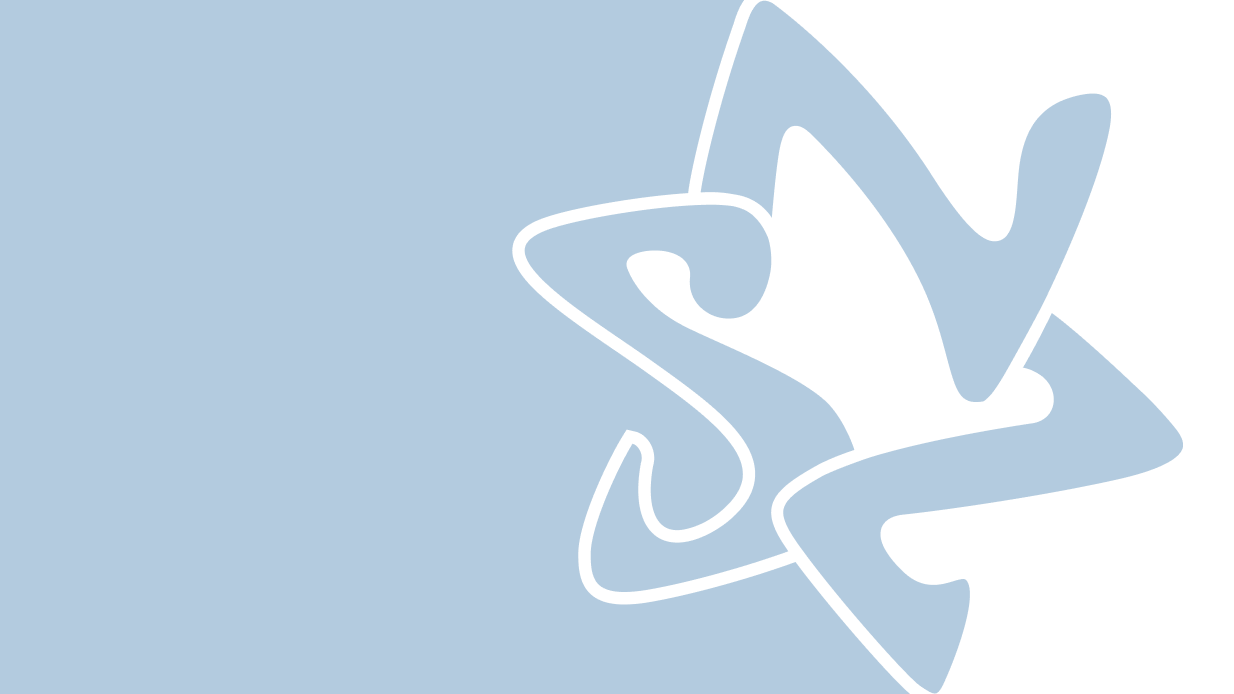Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes haben wir im Team Texte verfasst, die persönliche Gedanken und aktuelle Beobachtungen miteinander verbinden. Wir erinnern an diejenigen, die für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus gekämpft haben – und an die Millionen, die dem Terror zum Opfer fielen. Acht Jahrzehnte später stellen wir uns die Frage, was aus dem Versprechen „Nie wieder“ geworden ist. Antisemitismus, neue Konflikte und ein veränderter Blick auf Geschichte zeigen, dass auch unsere Erinnerungskultur nicht selbstverständlich ist – und dass sie immer wieder neu hinterfragt, verteidigt und weiterentwickelt werden muss. Gerade angesichts aktueller Entwicklungen rufen wir zur Wachsamkeit und zu aktiver Solidarität auf – besonders mit dem Staat Israel als Zufluchtsort der Shoah-Überlebenden. Die Beiträge möchten zum Nachdenken anregen und ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.
Ilana:
Für mich ist das Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Gedanken verbunden, dass meine Familie heute viel größer sein könnte. Dies sind nicht nur Gedanken über Hoffnungslosigkeit und Schmerz, es sind Gedanken über die Gerechten unter den Völkern, die ihr Leben riskierten und ihren Glauben an gute Menschen. Leider drängt sich der Gedanke auf, dass es noch mehr davon geben könnte. Dieser Gedanke beschäftigt mich heute besonders.
Alex:
Morgen ist der 80. Jahrestag der Kriegsbeendigung. Ich glaube, das Ende des Zweiten Weltkrieges war die größte Chance für eine friedlichere Welt, da wir als Menschheit hätten lernen sollen, was Krieg bedeutet – nach so vielen Toten und so viel Unglück. Nach 80 Jahren zeigt die heutige Situation leider, dass wir diese Chance verpasst haben.
Wer der Geschichte nicht gedenkt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.
Wir müssen uns erinnern und uns vergegenwärtigen, welcher Schmerz und welche Verluste nötig waren, um das Grauen zu beenden. An diesem Tag gedenken wir vor allem der Helden. Helden sind wichtig, und die Welt braucht sie. Aber ich hoffe, dass es nie wieder so schlecht um unsere Welt steht, dass wir erneut auf Millionen von Helden angewiesen sind – von denen viele nicht zurückkehren.
Doch leider zeigt sich in den letzten Jahren, dass diese Hoffnung enttäuscht wird.
Hoffentlich liege ich damit falsch.
Moritz:
Der 80. Jahrestag der Befreiung Europas und der Welt vom herrschenden Nationalsozialismus und dem damit einhergehenden Vernichtungswillen sollte zunächst denen in Dankbarkeit gewidmet sein, die diesem unter Einsatz ihres (oft jungen) Lebens ein Ende setzten: Partisaninnen, Soldaten der alliierten Streitmächte, Kämpferinnen und Kämpfer der roten Armee sowie allen Unzähligen im Kampf gegen die deutschen Nationalsozialisten und ihren Kollaborateuren Gefallenen.
Weiterhin mahnt der im vergangenen Januar begangene ebenfalls 80. Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz, welcher stellvertretend auch für die anderen Stätten der Shoah und des Holocausts steht, das gerne an solchen Tagen postulierte „Nie wieder“ konsequent umzusetzen, was heute eine Solidarität mit Israel als dem Staat der Shoah-Überlebenden zur Folge haben muss. Diese Solidarität, welche seit dem pogromartigen Überfall des 7. Oktobers dem sich im Existenzkampf befindlichen jüdischen Staat gegenüber nicht auf bloße Worte beschränkt sein darf, wird zurzeit leider aus unterschiedlichsten Richtungen in Frage gestellt.
Beispielhaft dafür stehen Szenen wie jene in Berlin, auf denen sich junge, oft akademisch und sich alternativ verortende Menschen für „free Palestine from german guilt“ skandierend starkmachen. Neben dem besorgniserregenden Anstieg rechtsradikaler und neonazistischer Gewalttaten und Aufmärschen findet ein solcher scheinbar progressiver Angriff auf die in Deutschland über Jahrzehnte mühsam aufgebaute Erinnerungskultur Tag für Tag im und aus dem akademischen Milieu heraus statt, und anders als bei obengenannten Rechtsradikalen, mit welchen sich deren Gegner beim Thema Israel oft erstaunlich nahe sind, bleibt der öffentliche Aufschrei oft aus.
„Nie wieder“, eine auch nach 80 Jahren eminente Losung, steht also heute ebenso unter Beschuss wie in längst vergangenen Jahrzehnten, in denen man vor lauter Wirtschaftswunder und Westanbindung gerne den Blick „nach hinten“ vergessen wollte.
Jasmin:
„Würde ich es zulassen, dass meine Söhne in den Krieg ziehen?“ Diese Frage habe ich mir in der letzten Zeit häufiger gestellt, insbesondere hinsichtlich der öffentlichen Diskussion um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Dass ich einmal hätte darüber nachdenken müssen, wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen.
Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist meine Vorstellung eines friedlichen Europas jedoch brüchig geworden und auch die Kriege an vielen anderen Schauplätzen der Welt zeigen, wozu Menschen in der Lage sind.
Menschenverachtung, Hetze, Mord. Davon sind wir nicht befreit, auch, wenn sich am 8. Mai 2025 das Ende des Zweiten Weltkrieges und somit die Befreiung vom Nationalsozialismus zum achtzigsten Mal jährt. Dass wir, unmittelbar vor unserer Haustür, vor 80 Jahren auch Krieg hatten, einen Krieg, bei dem über 60 Millionen Menschen getötet wurden und mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden von den Deutschen ermordet worden sind, erscheint angesichts der Tatsache, wie unbeschwert ich persönlich aufgewachsen bin, völlig surreal. Ich war sechs Jahre alt, als Primo Levi, Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz sagte: „Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen.“ Wir sollten also wachsam sein.
Bis 1933 war Kassel eine Stadt, in der mehr als 2300 Jüdinnen und Juden lebten und das kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben maßgeblich mitprägten. Nach der Machtergreifung Hitlers wurden antijüdische Gesetze und Ergänzungsverordnungen erlassen, Boykotte auf jüdische Geschäfte fanden statt, Enteignungen wurden durchgeführt. Auf dem Friedrichsplatz wurden im Mai 1933 Bücher verbrannt und 30.000 Menschen kamen, um sich dieses Spektakel als Schaulustige anzusehen. Zum Großdeutschen Reichskriegertag im Juni 1939 kamen 300.000 Soldaten aus dem Deutschen Reich in die Stadt. Am 7. November 1938 wurde die Kasseler Synagoge geschändet, Tausende Jüdinnen und Juden deportierte man vom Hauptbahnhof aus in Richtung Osten. Wenige überlebten den Holocaust.
Es ist 80 Jahre her, dass diese Gräueltaten, diese menschenverachtenden Handlungen der Nationalsozialisten, ihr Ende fanden. Sie liegen in der Vergangenheit. Das Erinnern findet jedoch in der Gegenwart statt. Keine 500 Meter Luftlinie von meinem Zuhause entfernt wurde am 4. April 1945 die Kapitulation Kassels bekannt gegeben. Nicht nur wegen dieser räumlichen Nähe hat das Ende des Zweiten Weltkrieges etwas mit mir zu tun, sondern auch, weil dieser Tag markiert, dass ich in der Gesellschaft Verantwortung dafür trage, ein klares Gegengewicht zu Ideologien der Ausgrenzung herzustellen, demokratische Werte nachhaltig für die zukünftige Generation zu sichern und auch mit Leben zu füllen.
Auch meine Söhne sind Teil dieser zukünftigen Generation. Mir ist es daher besonders wichtig – neben der Erinnerung an die Vergangenheit – Wissen zu vermitteln, das Urteilsvermögen zu fördern, selbst Haltung zu zeigen und den Blick für andere Perspektiven zu ermöglichen. Es darf keine Gleichgültigkeit entstehen, denn diese wirkt sich als Katalysator für extremistische, ideologisch motivierte und menschenverachtende Haltungen aus.
Durch die Arbeit im Sara Nussbaum Zentrum habe ich die Chance, aktiv dazu beizutragen, in der Gegenwart, in meiner Stadt, dem Hier und Jetzt jüdisches Leben und dessen Vielfalt sichtbar zu machen.
Elena:
Der 8. Mai ist für mich ein Tag des Erinnerns. Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Für meine Familie ist dieses Datum eng mit Verlust verbunden: Beide Großväter sind im Krieg gegen Nazi-Deutschland gefallen, und mehrere Angehörige wurden in der Shoa ermordet.
An diesem Tag haben wir uns in Kiew immer bei meinem Onkel versammelt. Wie durch ein Wunder konnte er im September 1941 der Menschenmenge in Babyn Jar entkommen – und so dem Tod entfliehen.
Ich lebe seit 33 Jahren in Deutschland und arbeite in einem jüdischen Zentrum. Umso schwerer fällt es mir, heute festzustellen, dass die Geschichte sich auf bedrückende Weise wiederholt. Russland führt einen Angriffskrieg gegen meine Heimat Ukraine, und auch meine Verwandten in Israel leben im Ausnahmezustand.
Gleichzeitig beobachte ich mit Sorge die jüngsten Wahlergebnisse in Deutschland, die immer wieder Parteien stärken, die demokratiefeindliche Tendenzen vertreten. Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, diese Ideologien zu unterstützen.
Dass meinen Kindern geraten wird, ihren Davidstern lieber nicht offen zu tragen, macht mich wütend und verzweifelt. Antisemitische Ausschreitungen deutschlandweit nehmen zu, und es scheint, als ob der Hass auf Jüdinnen und Juden wieder öffentlich salonfähig wird.
Umso mehr treibt es mich an, etwas dagegen zu tun – auch wenn ich nicht sicher bin, ob es mir gelingt.
Das Foto stammt von Dr. Markus Isaakowitsch Ejdelberg, der 1943 im Alter von 18 Jahren in der Roten Armee kämpfte und bis nach Berlin kam. Das hier gezeigte Foto wurde von ihm am 9. Mai aufgenommen. Nach dem Krieg unterrichtete er Physik an der Universität Simferopol.